Che faro oder Was mache ich heute
Seit April 2002 schreibe ich in größeren und kleinere Zeitabständen Texte unter dem Titel Was mache ich heute – Che farò senza Euridice, che farò senza il mio ben’, dove andrò… singt Orpheus. Und so wurde in fast hundert Texten immer wieder ein Weg von Euridice, Griechenland und Orpheus quer durch die Zeiten und Länder, und vor allem quer durch die Kriege gesucht, gefunden und vielen Fluchtwegen, auch in der eigenen Familiengeschichte, nachgegangen. 2002, dreiundzwanzig Jahre. Die Zeit, in der ich älter wurde, mir bewusst wurde, was ich erlebt hatte und welche Familiengeschichte ich hatte und was alles geschehen war. Auch mit mir. Jahre, in denen ich anfing, über all ‚das‘, was nie gesagt wurde, zu schreiben.
Was schrieb ich im April 2002:
Mit siebzehn habe ich in Amsterdam die beiden Pudel einer älteren Dame ausgeführt. Einer Dame, die Herrschaften empfing und gut Geld verdiente. Schön fand ich diese Dame. Sehr schön. Meinen vierzigsten Geburtstag habe ich in Frankfurt in einem Rotlichtlokal gefeiert, Kuchen mit vierzig Kerzen mitgebracht, ein paar Freunde, eine der Frauen tanzte ziemlich nackt und bloß, war schön nackt, schön rot, Kuchen gut, war schön. Einen Tag später geschah dann die schöne große ordentliche Geburtstagsfeier mit Frank Wolff am Cello und anderen Musikern, Musikerinnen, Tanz und Buffett: Frankfurt eben. Die Idee, dass das Leben manchmal doch ein kleines Freudenhaus sein könnte? Oder?
Ein Haus der Freude, das finde ich verlockend. Sich hingeben, etwas weggeben, etwas geschenkt bekommen, Freude. Aber was sagt Freud dazu?
Der Krieg hört auf und ein neuer beginnt. Privat, öffentlich, immerzu, es ist nicht zu stoppen. Die Menschen, sie sind so, wir sind so, ich bin es.
Ein niederländischer Freund sagte in einer Dorfversammlung in Ee fast verzweifelt, wir müssen mit diesen Menschen es tun, wir haben hier keine anderen. Er bat seine Freunde darum, bitte nehmt zur Kenntnis, dass wir nicht irgend etwas planen können und keiner im Dorf tut mit, weil alle anders denken. Nicht gegen uns, aber eben anders. Wir haben diese Menschen. Und diese oder jene Menschen heute machen Krieg da und dorten und immer wieder. Wir können es nicht lassen. Meint es der eine gut, meint es der andere schlecht, kommt der andere alle Schritte entgegen, schießt der eine zuerst. Ob im Freudenhaus es anders zugeht? Ein richtiges Haus der Freude – möglichst ohne Freud.
Oder doch mit ihm, damit er uns fast alles erklären kann. Na, da zitiere ich mich, das Ende einer Erzählung:
 Ich wünsche mir die Fähigkeit, auf meinem Platz zu leben, keinem besonderen und an keinem besonderen historischen Ort, schon an gar keinem, der erst erkämpft, weggenommen werden müßte. Ich möchte lernen in Skizzen zu leben und für jeden geglückten Tag an meinem Ort mit meinem Glück oder Unglück, mit meinem Mut oder meiner Feigheit einzustehen.
Ich wünsche mir die Fähigkeit, auf meinem Platz zu leben, keinem besonderen und an keinem besonderen historischen Ort, schon an gar keinem, der erst erkämpft, weggenommen werden müßte. Ich möchte lernen in Skizzen zu leben und für jeden geglückten Tag an meinem Ort mit meinem Glück oder Unglück, mit meinem Mut oder meiner Feigheit einzustehen.
Die mögliche Sprache der Verständigung muß nicht die Sprache sein, die ich beherrsche. Die Mühe möchte ich verwenden auf die Übersetzungen, auf die Entstehung von Langsamkeit in der Annäherung und in der Zeit, weil ich dann hoffen kann, Zeit für Zukunft zu haben.
Ganz schön moralisch. Jaja.
Na dann: Gut Schabbes und eine gute Woche. Lassen Sie Ihren Nachbarn einfach am Leben, für eine weitere Woche. Das ist schon viel, wenn er es auch tut. Und sie es tun. Und ich es tue. Fast wie Frieden, aber eben nur für diese paar Quadratkilometer.
Ein paar Monate später schrieb ich 2002:
Als ich ein Mädchen war, da träumte ich davon für ein Erbe aufgerufen zu werden und aus einer Opernloge zu schauen, in einem großen Bett zu liegen. Nicht allein. Aber mit wem genau, dass wusste ich noch nicht. Da waren noch keine Bilder. An Literatur habe ich nicht gedacht und eine mir gnädige Dame oder einen mir zugewandten Herrn kannte ich noch nicht, aber ich hatte ja auch keine Tausender in den Taschen. Nur die Groschen vom fortgeschafften Altpapier, vom Taschengeld. Und geträumt habe ich, tags und nachts und immer zu, auch wenn keine Zeit war wie in der Schule oder wenn Erwachsene mit mir sprachen: ich habe geträumt und mir gewünscht, dass ein Herr oder eine Dame ruft.
Als junge Frau dachte ich, die Liebe darf keinen Grund haben, weil sie dann vergeht, wenn sie einen Grund hat. Und heute weiß ich und fühle, jede Liebe hat einen Grund, da müssen keine Tausender auf dem Tisch liegen, das kann ein Duft sein, das Gesicht des anderen, die Hände, die Klugheit. Oder dass ein Mensch mich begehrt und will und liebt. Oder das mich eine Dame oder ein Herr braucht. Vergeht die Liebe, wenn der Grund weg ist? Nur Sehnsucht macht das Suchen erfolgreich, sagt Albert Einstein. Und die Sehnsucht vergeht mir nie, also suche ich lange bei dem Herr oder der Dame, die ich liebe und möchte immer noch zu einem Erbe aufgerufen werden und in einer Opernloge sitzen und genießen und schauen. Und schreiben. Denn das mache mit meiner Sehnsucht zu aller erst: schreiben, immer weiter schreiben und Welt erfinden, eine Menschenoper mit Liebe.
Ende 2002 schrieb ich:
Als ich auf die Welt kam und die Suche nach der Wirklichkeit begann – Familiengedächtnis, darüber beginne ich zu schreiben. Einer sagt: Als ich auf die Welt kam und einen Mann im grauen Kittel sah, wußte ich, daß ich bei armen Leuten gelandet war. Eine andere erzählt von ihrer Mutter, die in den Urwald radelt, eine Abwesende. Eine Dritte beschreibt ihre schöne Schwester, weswegen sie beschloss ein kluges kleines Mädchen, eine kluge Frau zu werden; dass sie schön ist, davon spricht sie nicht.
„Alle glücklichen Familien ähneln einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich.“ Das ist der erste Satz aus Anna Karenina.
Auf Familienfotos ist viel vom Unglück und Glück der Familien zu sehen. Es gibt ein Bild- und Körpersprache: es gibt ein Bild- und Körpergedächntnis. Familienfotos, was zeigen sie, was richten sie an, was wollen sie erinnert wissen, was verraten sie?
Aby Warburg, der Begründer der „Kulturwissenschaftlichen Bibliothek“ hat sich bemüht das Bildgedächntnis der europäischen Kunstgeschichte zu entziffern: Welche Erinnerungsarbeit ereignet sich in Bildern, welche Erfahrungen sehen wir? Die im Bild, auch in der Fotografie dargestellte, eingenommene Haltung, Gebärde ist eine symbolische Form, deren Eedeutung sich nur über die Erinnerung der darin aktualisierten Form und Erfahrung erschließt.
Die verschwiegenen Erinnerungen sind in den Erzählungen und Fotos nicht wieder zu finden, nicht auf den ersten Blick und nicht beim ersten Hinhören. Ich bin ziemlich bang, ob mir das Schreiben gelingt. –
 So war das also – mein Zustand am Anfang der vielen dann folgenden Che faros – Was mache ich heute.
So war das also – mein Zustand am Anfang der vielen dann folgenden Che faros – Was mache ich heute.
Ich schreibe – immer noch und immer weiter.
https://www.jmonikawalther.eu/chefaro.php
Als der Zweite der Weltkriege vorbei war
Als ich in Leipzig auf die Welt kam, war der Zweite der Weltkriege gerade vorbei. Europa stand in Trümmern. Die Zukunft war auf den Tag beschränkt. Auf die nächste aufgesparte Scheibe Brot, gebacken aus mehr Sägespane als Mehl. Millimeterdünn geschnitten. In Kaffeesatz geröstet. Kartoffelschalen. Zu Brei verkocht. Graupen in Wasser. Linsen in Wasser waren Luxus. Milch gab es nicht, aber meine Tante trieb Hafermehl auf. Ein Arbeitskollege gab ihr Harzerkäse gegen Damasttischdecken. Tante Elisabeth hatte die Silberbestecke ausgegraben und tauschte sie nach und nach um in Zucker, Fette. Kartoffeln. Einmal ergatterte sie Reis und Kakao. So lernte ich als Kind nach den Sägespänen auch Grieben und Harzerkäse zu essen. Selten winzige Speckstücke. Immer alles langsam kauen.
Die weißen Rosenbüsche in der Idastraße blühten im Sommer 1945. Im Winter erfroren die meisten der Stöcke. Im Hungerwinter von sechsundvierzig auf 1947 war an Weihnachten nicht zu denken. Meine Tante legte die schönste und größte der Damastdecken auf den Tisch und erzählte, wie in den guten Zeiten alle zum Schabbat, zu Weihnachten zusammenkamen. Vor 1940, bevor fast alle der großen Leipziger-Berliner Familie aus Deutschland geflohen waren. Nach England, in die Vereinigten Staaten, nach Kanada, Frankreich, in die Niederlande, nach Italien. Ein Onkel landete bei dem Fliehen vor den Deutschen in Burma und heiratete eine Prinzessin, dann kamen die Japaner und sie flohen weiter nach Macau.
Weißt du noch, damals an den Freitagabenden als alle an dem großen Tisch saßen, durcheinanderredeten und lachten, die Brüder über Politik stritten, damals als alle noch in Leipzig und Berlin waren. Wie sie alle Pläne hatten, was sie werden wollten. Damals in der Idastraße. Aber daraus wurde nichts. Eine der großen Tischdecken aus Damast habe ich noch. Um sie für den großen Tisch in unserem Haus zu nutzen, muss sie in der Länge und Breite auf die Hälfte gefaltet werden. Zu Weihnachten. So wird einmal im Jahr an meinem Tisch an eine andere Gesellschaft gedacht. Deutschland, wie es nicht werden konnte. Deutschland, wie es sich um Zukunft, Wissen und Gefühle brachte.
In den guten Zeiten saßen an dem großen Tisch in Leipzig sechszehn und mehr Menschen, verwandt, verlobt. Sie aßen, lachten, redeten, schmiedeten Zukunftspläne. Sie hatten alle noch so viel vor und meine Großeltern bestärkten sie. 1940 im Sommer gab es nur noch meine Großeltern und die Jüngste, meine Mutter. Die großen Feste waren vorbei. Die Großeltern starben, meine Mutter verschwand, sie wurde unsichtbar.
Nach den eiskalten Hungerwintern gab es das erste Weihnachten, das ich erinnere. Der allererste Adventskalender meines Lebens. Tante Lisbeth hatte eine Schnur, an der sie Streichholzschachteln festband, im Esszimmer an einen Tannenzweig gehängt. Vierundzwanzig Mal schnitt ich eines der bunt beklebten Kistchen ab, zog sie auf und erlebte eine Überraschung: eine Walnuss. Eine Rosine. Einen goldenen Stern. Eine kleine Silberkette. Nach der vierundzwanzigsten Schachtel war Chanukka vorbei und es war Weihnachten. Tante Lisbeth lachte gerne. Und Onkel Jacob erzählte Geschichten aus der Welt. Das war schön. Das war noch in Leipzig. Die Stadt, aus der ab 1933 außer meinen Großeltern und meine Mutter alle geflüchtet waren, um wenigstens ihre Leben zu retten. Manche kamen zurück, um einige Jahre später noch einmal ihre Heimat verlassen zu müssen. Tante Lisbeth und Onkel Jacob verpassten den Zeitpunkt. Beide waren sofort nach Kriegsende aus Liverpool zurück nach Leipzig gekommen. Zurück in ihre Heimat, die zum Gefängnis wurde. Sie durften nur je einmal getrennt ausreisen. Onkel Jacob im Sommer, Tante Lisbeth zu einem Weihnachtsfest. Sie wollten weg, aber nicht allein.
In meiner Kindheit war oft vom Festhalten des Augenblicks die Rede. Wortwörtlich. So ein Tag, so schön wie heute, der dürfte nie vergehen. Wurde gesungen, gemeint war diese Sekunde und dieser eine Blick. Das war der Wunsch, als die schlimmsten Zeiten, die Kälte, der Hunger überstanden, die Zonen getrennt waren. Nicht erinnern und nicht planen. Der erste Schaumwein. Trinken. Die erste Schokolade. Aufreißen und essen. Nylonstrümpfe. Ein Ei. Roh oder gekocht. Verschlingen. Eine fette Leberwurst. Fingerdick aufs Brot schmieren. Endlich. Die Währungsreform im Westen hatte auch in der Ostzone die Schaufenster für ein paar Tage mit Waren gefüllt. Harte Kastenbrote. Graue Leberwurst. Grieben. Kartoffeln. Klumpiges Mehl. Bleiche Nudeln. Der Laden meiner Großmutter stand immer noch leer. Aber es ging vorwärts. Mit roten Fahnen und neuen Bonzen.
Meine Mutter und ich flüchteten aus der DDR 1952, mit zwei Rucksäcken, einer Handtasche und einem großen Holzkoffer. Bei Nacht und Schnee in die Tschechoslowakei. Mit Zügen, ohne Fahrkarten und Papiere. Ohne Zuzugsgenehmigungen für irgendeine der Zonen. Weiter nach Bayern ins Lager Moschendorf. Bis Kriegsende ein KZ. Meine Mutter hielt die Menschen, den Dreck, die Enge nicht aus. „Keine Lager, keinen Schmutz mehr“, sagte meine Mutter. Sie war einige Monate in einem der Lager gefangen gewesen. Wir flüchteten weiter bis an den Bodensee. Ein Buchhändler floh mit uns. Er hatte in Leipzig seine Lehre als Buchhändler absolviert. Er floh nach Hause. Friedrichshafen. Blick auf den Säntis. Bei klarem Wetter.
Als ich den Berg, den Säntis mit seiner weißen Mütze, das erste Mal sah, wusste ich seinen Namen nicht und auch nicht, dass am anderen Ufer die zugesperrte Schweiz lag und dass es dort Dinge gab, die ich noch nie im Leben zuvor gesehen, geschmeckt und gerochen hatte: Schokolade, Orangen, Bananen, Milch, Kakao und Marzipankuchen. Nugat. Schoggi. Ich wusste auch nicht, dass es hinter diesen weißen Bergen noch sehr viel mehr Welt gab.
Was hatten wir aus Leipzig mitgebracht? Was war in dem Holzkoffer? Eine Damasttischdecke, Silberbestecke, Papiere zum Besitz des Hauses in Leipzig. Kleidung. Großvaters Säbel. Großvaters Sattlerwerkzeuge. Großvaters Taschenuhr und sein Seidenschal. Abtrockentücher aus Großmutters Bestand, bestickt und noch unbenutzt. Einige Fotoalben. Eine Pelzstola. Eine Lederetui mit einer silbernen Schere und einem silbernen Fingerhut. Ein merkwürdiges Sammelsurium.
Als Kind fragte ich die Verwandten oft, was war in deinem Koffer? Die nach England geflüchteten Blumenthals landeten ohne Gepäck in Liverpool, ihnen waren nur die Rucksäcke und zwei Aktentaschen geblieben. Die meisten gingen unauffällig mit zweifach angezogener Kleidung, Handtaschen und Rucksäcken. Niemand wollte erkennbar über die deutschen Grenzen, nur Verwandte, Freunde in der Nähe besuchen. Nur ein Ausflug. Die Zugfahrten waren sorgfältig bedacht und verliefen selten wie geplant. Da standen Gestapomänner auf dem Bahnsteig, da durchsuchte die SS einen Zug. Oder andere Reisende wurden abgeführt. Lieber noch einmal im Kreis fahren. Und auch wer die Genehmigung für eine Ausreise hatte, verhielt sich unauffällig. Ein kleiner Koffer. Besitz und Geld musste mit Hilfe anderer gerettet oder als verloren ausgebucht werden in der Lebensbilanz. Millionen Mal musste die Existenz, alle Gefühle, Wissen und Können, alles Leben ausgebucht werden. Keinen Hut mehr zum Ziehen, Kein Lächeln. Kein Guten Tag der Nachbarn mehr. Keine Luft mehr zum Atmen.
 Meine Mutter und ich kamen über alle Zonengrenzen bis an den Bodensee und fanden einen Unterschlupf in der Drachenstation, direkt an der zerstörten Ufermauer gelegen. Ein neuer Lebensroman. Der Sinn war zu leben. Nach dem Überleben. In der Fremde zu leben.
Meine Mutter und ich kamen über alle Zonengrenzen bis an den Bodensee und fanden einen Unterschlupf in der Drachenstation, direkt an der zerstörten Ufermauer gelegen. Ein neuer Lebensroman. Der Sinn war zu leben. Nach dem Überleben. In der Fremde zu leben.
Vor der ehemaligen Wetterstation bogen sich Bahngleise in die Luft, ein zerbombter Kran hing quer ins Wasser. Wir schliefen auf Strohsäcken, hatten nichts zu essen, waren Fremde. Mit den Monaten kamen immer mehr Flüchtlinge aus der DDR, Geflüchtete aus den baltischen Ländern, aus Schlesien und Ostpreußen waren schon länger da. Die Einheimischen waren nicht begeistert von all den Fremden, die das Schwäbisch nicht verstanden und keine Ahnung hatten was Geselchtes und Gsälz war. Die meisten Schwaben mochten keine Flüchtlinge, gleich woher sie kamen. Alles ein Pack. Hungerleider. Und dieses Pack konnte nicht nur kein Schwäbisch, sondern war auch nicht katholisch. Protestanten, Alt-Lutheraner, . Und dann waren da noch die französischen Soldaten und ihre Familien.
Das erste Weihnachten am See, in der ausgebombten Stadt Friedrichshafen, fand in der Schiffswerft neben der Drachenstation statt. Hafenarbeiter und Matrosen hatten einen Tannenbaum geschlagen, Kerzen gegossen, Sterne waren gebastelt worden. Der Mann, dem die großen Kieshaufen gehörte, brachte eine Krippe und stellte sie unter den Baum. Die Kinder, die Blockflöten hatten, mussten Weihnachtslieder üben. Ein Matrose verkleidete sich als Nikolaus, einer als Knecht Ruprecht. Der Schnee lag hoch und es war sehr kalt. Die kleinen Bolleröfen knatterten laut. Auf jedem stand eine Blechkanne mit Tee, Kaffee und Wein. Als es dunkel wurde, kamen immer mehr Menschen in die Werft, auch die drei Männer, die neben der Drachenstation in einer Baracke lebten und immer noch ihre gestreiften Lagerjacken trugen. Ein aus Afrika heimgekehrter Missionspfarrer las die Weihnachtsgeschichte, sprach ein Gebet und einen Segen. Alle sangen, die Kinder piepsten auf ihren Flöten. Dann verteilten die Einheimischen an die Flüchtlinge Brezeln und wir Kinder bekamen alle ein Weckle und einen Schübling. Zum Schluss gab es noch Geschenke, alle hatten sich eine Kleinigkeit überlegt: Die drei Männer hatten Walnüsse gesammelt und aus Kastanien kleine Figuren gebastelt, die Matrosen aus der Schweiz einen Block Schokolade mitgebracht und in kleine Stücke geschnitten. Meine Mutter verschenkte zwei Spitzenuntersetzer, und ich hatte vier Kartoffeln von einem Lokomotivführer, der seinen Garten hinter der Drachenstation hatte, erbettelt und jede in Papier gewickelt. Dann tobten wir Kinder durch die Werft und die Erwachsenen tranken Glühwein oder Tee und Kaffee mit einem Schuss Rum und redeten. Woher sie kamen, wo sie Unterschlupf gefunden hatten, wie es weitergehen sollte. Nicht alle wollten am Schwäbischen Meer bleiben. Manche wollten in die Schweiz oder in eine andere Zone, in ein anderes Bundesland zu Verwandten.
 Friedrichshafen war eine sehr zerbombte Stadt. Die vier großen Rüstungsbetriebe Luftschiffbau Zeppelin, Maybach Motorenbau, die Zahnradfabrik und die Dornierwerke waren Ziel der Angriffe gewesen. Vierzehntausend ausländische Zwangsarbeiter und über tausend KZ-Häftlinge schufteten in diesen Werken. Bis April 1945 errichteten Häftlinge einen unterirdischen Stollen bei Überlingen, den Goldbacher Stollen, um die Rüstungsindustrie aus Friedrichshafen zu verlagern. Elf Luftangriffe gab es zwischen 1943 und Februar 1945. Nur der Mut des Bürgermeisters und vieler Einwohner verhinderte, dass die Stadt bis zum letzten Haus verteidigt wurde. Zum Kriegsende lebten nur noch siebendtausendsechshundertfünfzig Menschen in der Stadt. Bei Kriegsbeginn waren über fünfundzwanzigtausend gewesen. Die drei Männer aus der Baracke neben der Drachenstation waren Häftlinge gewesen, Ukrainer. Nach Hause wollten sie auf keinen Fall, nicht in die Hände der Russen fallen. Das hätte ihren Tod bedeutet.
Friedrichshafen war eine sehr zerbombte Stadt. Die vier großen Rüstungsbetriebe Luftschiffbau Zeppelin, Maybach Motorenbau, die Zahnradfabrik und die Dornierwerke waren Ziel der Angriffe gewesen. Vierzehntausend ausländische Zwangsarbeiter und über tausend KZ-Häftlinge schufteten in diesen Werken. Bis April 1945 errichteten Häftlinge einen unterirdischen Stollen bei Überlingen, den Goldbacher Stollen, um die Rüstungsindustrie aus Friedrichshafen zu verlagern. Elf Luftangriffe gab es zwischen 1943 und Februar 1945. Nur der Mut des Bürgermeisters und vieler Einwohner verhinderte, dass die Stadt bis zum letzten Haus verteidigt wurde. Zum Kriegsende lebten nur noch siebendtausendsechshundertfünfzig Menschen in der Stadt. Bei Kriegsbeginn waren über fünfundzwanzigtausend gewesen. Die drei Männer aus der Baracke neben der Drachenstation waren Häftlinge gewesen, Ukrainer. Nach Hause wollten sie auf keinen Fall, nicht in die Hände der Russen fallen. Das hätte ihren Tod bedeutet.
Nicht ganz zerstört worden, war die Schlosskirche am anderen Ende der Uferpromenade. Ihre Zwiebeltürme waren immer in der Ferne zu sehen. Der Südturm war abgebrannt und der Dachstuhl schwer beschädigt. Mit Schweizer Hilfe wurde ein Notdach errichtet.
Die Schlosskirche war eine wunderschöne evangelische Barockkirche und so trafen sich am nächsten Weihnachten alle Geflüchteten dort wieder. Die Kinder mit ihren Flöten, ein kleiner Chor, der Pfarrer, die Fremden, denn die waren protestantisch, die Einheimischen katholisch. Von der Eriskirche in der Stadtmitte stand nur noch der Turm.
Als es am Heiligen Abend dunkel wurde, blieben die Katholiken in der Stadt, die Fremden bildeten zusammen mit den französischen Soldaten und ihren Familien einen Zug entlang der Uferpromenade. Immer weiter und vorbei an einem Hafen für Segelboote und noch weiter bis zur Schlossstraße. Entlang der Mauer, die die Kirche mit ihren vielen Eingängen umgab, zum Haupttor. Der Schnee lag hoch. Eisenbahner hatten Laternen mitgenommen und so war die Menschenkette am See von der Stadt aus zu sehen. Die Alpen, der Säntis, der See und davor der Lichterzug zur Schlosskirche. Wir Kinder rannten vom Schlosssteg zum Schlosshorn und weiter zu dem Pavillon Mon Plaisir und wieder zurück zu den Erwachsenen, die sich in der eiskalten Kirche um den Altar und den Tannenbaum und die Krippe drängten. Wir Kinder waren dick eingepackt und saßen unter dem Tannenbaum am Altar. Der Pfarrer erzählte den Fremden von der afrikanischen Fremde. Viel gesungen wurde in allen möglichen Sprachen. Die Weihnachtsbotschaft, die Flötentöne piepsten, der Segen und alle sangen Oh du Fröhliche. Dann durfte jedes Kind sich ein Päckchen unter dem Baum holen. Ein Apfel, eine Orange, ein Gebäckstück, ein bunter Schokoladenkringel. Alle umarmten einander, schüttelten Hände, wünschten sich Frohe Weihnachten, ein paar wenige sprachen Polnisch, Lettisch, Tschechisch oder Russisch. Gott segne euch, sagte der Pfarrer noch und gab auch jedem die Hand.
Nein, zurückgeholt werden konnte die verlorene Heimat nicht, nicht die Wörter über das Elend, aber die Schlesier schenkten den Juden eine selbst gemachte Weißwurst. Eine baltische Familie musizierte. Wir lernten singen und neue Wörter. Die Franzosen verteilten warme Maronen und Marmelade. Der Pfarrer verschenkte Äpfel und Nüsse. Und es fanden sich immer mehr Worte. Gesten. Leben. Hilfe.
Dann wurden die Laternen wieder angezündet und der Zug wanderte an den zerbombten Ufermauern zurück in die Stadt. Ein paar Jahre lang fanden die Fremden an Heiligabend sich in diesem Gang zur Schlosskirche zusammen. Der Baum wurde prächtiger. Zu den Flöten kamen Geigen. Der Chor wurde größer und übte jeden Monat. Der Pfarrer wurde ordentlicher Gemeindepfarrer. Die Kirche wurde repariert und restauriert. Und die Flüchtlinge hatten sich auf verschiedene Weise in das Leben in eingefunden. Auch wir Kinder hatten uns zu neuen kleinen Rudeln sortiert.
Meine Mutter und ich wohnten inzwischen in der Eckenerstraße, neben dem Stellwerk und den Trajektgleisen. Inzwischen fuhren wieder Fähren in die Schweiz und Schiffe nach Lindau und Konstanz, Meersburg und Bregenz. Wir Kinder aus der Nachbarschaft tobten gemeinsam durch die Ruinen. Im Dezember 1953 lag der Schnee meterhoch. Niemand kam mit dem Schneeräumen hinterher. Die Berge wurden immer höher. Die wenigen Autos fuhren im Schritttempo. An Heiligabend fielen die Flocken immer dichter und schneller. Wir Kinder liefen durch die Stadt, immer weiter, bis zum Schlosssteg am Ende der langen Uferpromenade. Wir waren aufgeregt. Der Schnee, Weihnachten, vor dem Gang zur Kirche hatte Frau Beck ihren Kindern, Regina und Heinz, und mir Kakao und einen Wecken mit Wurst versprochen. Wir schrien und warfen mit Schneebällen, schmissen uns in einen Schneehaufen, gruben uns ein, jubelten: Die finden uns nie. Da saßen wir und waren glücklich, mit hochroten Köpfen, warm eingemummelt. Wir teilten einen Keks, den Regina vom Backblech ihrer Mutter gemopst hatte. Wir wurden stiller und müde, bald schauten nur noch unsere bunten Mützen aus dem Schneeberg. Die Dunkelheit ließ uns unsichtbar werden. Wir schliefen ein, wir waren verschwunden. Und die ganze Stadt suchte nach uns. Die Gottesdienste wurden verschoben. Polizisten, Feuerwehr und französische Soldaten suchten mit Laternen und langen Stöcken die Promenade und alle Straßen zur Promenade ab. Wäre nicht die Küsterin gewesen, die den Ofen in der Kirche heizte und durch den aufgeregten Pfarrer von der Suche erfuhr, die in immer größeren Kreisen zusammen mit ihrem Hund um die Schlosskirche nach uns suchte. Vom Badehaus, entlang der Wege bis zum Schlosshorn und Schlosssteg, dort stieß sie auf zwei französische Soldaten, die sich durch die riesigen Schneehaufen stocherten. Aber es war der Hund, der uns fand, bellte, kratzte, jaulte. Wir wurden halb erfroren wach. Die Soldaten zogen uns aus dem Schnee und trugen uns in die Kirche, dann liefen sie in die Stadt.
Wir saßen ins Decken gehüllt neben dem Ofen, tranken heißes Wasser, aßen Kekse und wussten nicht, wie uns geschah. Nach und nach kamen Menschen aus der Stadt zum Weihnachtsgottesdienst. Frau Beck setzte sich zu ihren Kindern und hielt sie fest in ihren Armen, obwohl Heinz schon zehn Jahre alt war. Für die Gemeinde waren wir das Weihnachtswunder. So laut und voller Freude wurde nie wieder O du Fröhliche gesungen.
All ich älter war, sang ich im Kirchenchor, saß gerne bei allen Gottesdiensten auf der Empore, aber unvergessen diese ersten Weihnachten am Bodensee, wenn wir zur Kirche liefen, sangen und die Erwachsenen miteinander redeten. Endlich gab es wieder Worte. Auch wenn die Sätze sich meist entlang der Fluchten und der verlorenen Heimat hangelten.
Wie schrieb Hilde Domin:
„Das eigene Wort,
wer holt es zurück,
das lebendige,
eben noch ungesprochene Wort?“
© J. Monika Walther
www.jmonikawalther.eu
Fluchtlinien: EBook und Taschenbuch

Die Glühbirne am Strand
Im langen Schriftstellerinnenleben gab es viele Zusammenarbeiten. Schon der Start mit achtzehn Jahren war eine Vorlage für Teamarbeit. Hans Magnus Enzensberger und der Südwestrundfunk luden mich in einen Jazzkeller nach Pforzheim ein. Der eine suchte Texte aus, eine Schauspielerin lass, Musiker spielten und ich durfte ein paar Antworten in ein Mikrophon sprechen. Hörspiele entstehen durch Zusammenarbeit und Diskussionen. Fast elf Jahre habe ich mit Vibeke von Saher gemeinsam Regien, Hörspiele und Feature entwickelt. Wir waren oft tagelang zusammen voller Intensität. Die Fotografin Barbara Dietl schickte mir ein Jahr lang jeden Monat eine Fotografie, ein Bild und ich schrieb dazu eine Geschichte: zu besichtigen und zu lesen in ‚Das Gewicht der Seele‘, herausgegeben von Iris Noelle-Hornkamp. Mit ihr gab es eine lebenslange Begleitung, durch die mir immer klarer wurde, welche jüdische Geschichte ich habe und was ich eigentlich in einer Art Puzzle erzähle.
Seit Bestehen schreibe ich für ‚Aus dem Alltag – Die Welt ist eine Laienbühne‘, herausgegeben von Manfred Lipp https://www.ausdemalltag.at/category/ausdemalltag/ kurze Prosastücke, Gedichte, zu denen Doris Lipp aus ihrem Schatz der Fotografien ein Bild auswählt. Inzwischen schreibe ich zu ausgesuchten Bildern von ihr Erzählungen. Wieder eine Zusammenarbeit. Zu der letzten Geschichte vom Weltenrand Bodensee (nach dem letzten Krieg, als viele Flüchtlinge in Oberschwaben gelandet waren) schickte sie mir eine Mail:

Liebe Jay,
Was für ein wunderbarer Text zu der Glühbirne am Strand! Er fließt und strömt und trifft ganz genau die Stimmungen quer durch die Lebensphasen. Ich habe mich beim Lesen gefragt, ob es vielleicht gar nicht so wichtig ist, in welcher Zeit und Umgebung wir aufwachsen und leben. Ob man vielleicht in jedem Leben während der unterschiedlichen Phasen die selben Themen bearbeiten soll. Unbestritten gibt es schwierige Zeiten und einfachere in der Geschichte, aber vielleicht sind trotzdem die Grundthemen gleich. Ich fand mich völlig wieder in deiner Beschreibung der Kindheit, separiert von den Erwachsenen, in einer Phantasiewelt mit ganz anderen Prioritäten. Und dem Gefühl, so viel zu können, so viele Geheimnisse zu entdecken zu haben, so viel Zeit natürlich auch.
Und dann die Phase um die fünfzig, wenn sich die Reihen der älteren Familienmitglieder bedenklich lichten und man sich neu verorten muss im Gefüge der Übrigen.
Im Text verwoben mit den persönlichen Erfahrungen ist die Geschichte der Menschheit überhaupt, die ewigen Fragen und die ewig fehlenden Antworten. Der Krieg, ein Ereignis, das sich in der Vergangenheit abgespielt hat, unvorstellbar für die meisten, selbst davon betroffen zu sein. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein. Die trügerische Ruhe ist vorbei, die Bedrohungen sind viele. Für uns optimistischen Kinder der 70-er und 80-er ein ganz neues Gefühl, das viele einfach wegschieben. Das neue Biedermeier ist entstanden, es wird um den heißen Brei herum geplaudert und „Alles gut?“ gerufen. Mehr eine Beschwörung, als eine Frage. © Doris Lipp
Solche Briefe, Mails oder Hinweise in Gesprächen sind etwas kostbares. Nicht wegen des ‚Lobes‘, sondern wegen der Spiegelung, der Fragen. Wegen der Glasbirne im Sand und den gefundenen Worten. Warum schreibe ich zu einer Glühbirne in der Sonne die Geschichte vom Weltenrand Bodensee nach dem letzten Krieg? Warum fotografiert Doris Lipp dieses Bild? Was ist geschehen?
Fluchtlinien – wie die Welt sich in Innen und Außen teilte
Claudia Marcy: 2023 erscheint „Fluchtlinien – Wie die Welt sich in Innen und Außen teilt“, in der Sie Ihre Familiengeschichte zum Thema machen. Wie kann man „Fluchtlinien“ beschreiben – als autofiktionalen Roman, in dem sich Autobiografie, historische Fakten und Fiktion durchdringen – vergleichbar mit den Texten der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux?
 Begonnen hatte ich vor Jahren mit vierzig Seiten über meinen Geburtsort Leipzig, die ich atemlos geschrieben habe, aber wie weiter? Auf der Suche nach Wahrheit tauchen viele Legenden auf, kleine und große Geschichten, die nicht wahr sind und doch erzählen, was gewesen ist oder gewesen sein sollte. Eine Selbstbeschau sind die Fluchtlinien nicht. Nein, ich schreibe die Geschichte einer Familie, meiner jüdischen, schlesischen, preußischen Familie, die Wanderungen von Ost nach West, der schließlich gelungene Aufstieg während der Gründerzeit in Leipzig; ich schreibe diese Geschichte so wahr wie möglich, aber eben auch mit ihren Legenden, Lügen und all den schwarzen Flecken. Und da ich ja dazu gehöre, schreibe ich auch über mich. Meinen Weg vom Rand, vom Nichtwissen bis hin zum Begreifen, wie ich dazugehöre.
Begonnen hatte ich vor Jahren mit vierzig Seiten über meinen Geburtsort Leipzig, die ich atemlos geschrieben habe, aber wie weiter? Auf der Suche nach Wahrheit tauchen viele Legenden auf, kleine und große Geschichten, die nicht wahr sind und doch erzählen, was gewesen ist oder gewesen sein sollte. Eine Selbstbeschau sind die Fluchtlinien nicht. Nein, ich schreibe die Geschichte einer Familie, meiner jüdischen, schlesischen, preußischen Familie, die Wanderungen von Ost nach West, der schließlich gelungene Aufstieg während der Gründerzeit in Leipzig; ich schreibe diese Geschichte so wahr wie möglich, aber eben auch mit ihren Legenden, Lügen und all den schwarzen Flecken. Und da ich ja dazu gehöre, schreibe ich auch über mich. Meinen Weg vom Rand, vom Nichtwissen bis hin zum Begreifen, wie ich dazugehöre.
Claudia Marcy: Wer Ihre Romane, Essays, Gedichte und Texte kennt, weiß, dass Sie sich schon lange mit Ihrer Herkunft und Ihrer Herkunftsfamilie beschäftigen. Wann kam der Entschluss, tatsächlich den verschiedenen Familienlinien nachzugehen?
Das Thema hat mich lebenslang beschäftigt. Als Kind fragte ich und es gab keine Antworten. Dann gab es die Verwandten kreuz und quer in der Welt. Ich wurde in Züge gesetzt nach Haarlem, Boulogne-sur-Mer, Liverpool. Es gab Post aus Kanada und den Vereinigten Staaten. Tanten und Onkel erzählten dies und das, kleine Spuren wurden gelegt. Irgendwann bekam ich dann Notizbücher, meine schweigende Mutter hinterließ einiges, eine meiner Cousinen auch. Und ich musste mich um die Idastraße, das Haus der Großmutter in Leipzig kümmern. 
Claudia Marcy: Wie muss man sich Ihre Arbeit vorstellen? Haben Sie in Archiven geforscht, Anfragen bei Behörden gestellt, in alten Akten und Dokumenten geblättert, Stammbäume von den verschiedenen Familienzweigen erstellt? Kontakte zu weit entfernt lebenden Familienmitgliedern aufgenommen? Stand für Sie von Anfang an fest, wessen Lebensgeschichte Sie verfolgen wollen, oder hat sich das im Laufe der Recherchen geändert?
Die mir aus der Familie übergebenen Dokumenten und Fotografien waren eine Grundlage, auch meine eigenen Notizen, viele Briefe, zahllose Ordner zum Leipziger Haus. Recherchieren musste ich natürlich einiges, aber viele Archive sind ja online zu benutzen. Selbst alte Militärakten ließen sich so finden. Oder die ganze Geschichte der Schriftgießerei Böttger in Leipzig oder dieder Äcker in Anger und Crottendorf vor den Toren der Stadt Leipzig, die von den Brüdern Wohlrath gekauft und bewirtschaftet wurden.
Claudia Marcy: Sind Sie zu Originalschauplätzen gereist? Hilft das bei der Recherche – schließlich haben sich die Menschen, die Häuser, die Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten verändert.
Bei den Reisen durch Polen, Litauen und Lettland, sei es wegen eines Stipendiums in Ventspils oder zur Schriftstellerin Helga M. Novak, habe ich immer Wege gesucht, um Familienorte wie Posen/Poznań, Hirschberg/Jelenia Góra oder den Landkreis Goldberg-Haynau kennen zu lernen. Dort ist noch Vieles so, wie es einmal war. Ich wollte fühlen, wie sie die Schneekoppe gesehen haben, welche Weg sie hatten.
Claudia Marcy: Haben Sie einige Überraschungen erlebt, als Sie sich mit Ihrer Familien beschäftigt haben?
Die Überraschung kam am Ende des Buches, als ich endlich begriffen hatte, dass ich nicht irgendwo am Rand dieser jüdischen Familie stehe, sondern dass ich dazugehöre, auch wenn ich in Deutschland die Letzte bin, aber in den Vereinigten Staaten gibt es eine große Verwandtschaft. Auch wenn ich immer noch vieles nicht weiß, bin ich nun erwachsen. Und alle haben genug für mehrere Leben erlebt. Gefreut hat mich, dass meine Großmutter, die Kolonialwarenhändlerin, aus der Familie der Schriftgießerei Böttger kommt. Die Familie war ja so groß, weil die Großeltern vor ihrer Verbindung schon einmal verheiratet waren. Großmutters erster Mann fiel sofort im 1. Weltkrieg, Großvaters erste Frau starb an der Spanischen Grippe.
Claudia Marcy: Das Manuskript ist fertig. Was gibt es jetzt für Sie zu tun und was steht Neues an?
Im Augenblick bin ich beim zweiten Korrekturgang. Das Buch soll nächstes Jahr erscheinen. Zum Herbst hin. Und wie immer entsteht schon wieder etwas Neues, das gar nicht neu ist, denn ich wollte schon immer ein Tagebuch der unmöglichen Reisen schreiben.
( Dülmener Zeitung 30.11.2022,Gespräch zwischen der Journalistin Claudia Marcy und Jay M. Walther)

Lesebuch Jay Monika Walther
Münster 1966
Mit dem Reifezeugnis im Koffer fuhr ich zwei Tage nach der Abschlussfeier in Heilbronn am Rhein entlang bis nach Münster. 1966. Ich stand mit meinem Koffer auf dem Domplatz und heulte. Mich trösteten die alten Kastanienbäume und das schöne Institut für Publizistik. Dort werde ich studieren. Ich brauchte ein Zimmer und Geld. Ich hörte Geschichte, Soziologie bei Luhmann, Philosophie, Psychologie. Lernte Statistik und Empirie. Schrieb Seminararbeiten zum Thema Hörspiel. Schrieb Filmkritiken für die Westfälischen Nachrichten und ergatterte eine kleine Stelle in der Bibliothek des Institutes. Ich wurde Mitglied der Roten Zelle. Wir besetzten das Institut. Dem damaligen Rektor, der nach dem Rechten sehen wollte, versperrte ich den Zugang: Sie haben hier nichts mehr zu sagen. Selbstverwaltung. Ich strich den Vorraum in Rot. Einige warfen Bücher vom Dach des Institutes in den Garten der Nonnen, einige wollten im Archiv Material zerstören, einige bauten vor die Tür von Professor Prakke, einem Niederländer, einen Stacheldrahtverhau. Dreimal stellte ich mich dagegen. Mit aller Heftigkeit. Der erste Riss in mir war da. Da nützen all diese nie endenden Versammlungen und Reden nichts. Ich schloss mich der Gruppe an, die im Institut kochte und aufräumte. Die Spaltungen begangen. Ja, ich sperrte eines Tages Dr. Lerg in seinem Büro ein, dann fiel mir ein, dass er seinen Hund bei sich hatte und schloss wieder auf. Später schrieben und arbeiteten wir zusammen über die »Werthaltungsanalyse publizistischer Aussagen«. Der Aufsatz hat bis heute
Bestand. 
Viele Demonstrationen. Eine bei Kiesingers Besuch in Münster. Ich hatte eine Tüte mit gemahlenem Pfeffer, mir gegenüber stand an der Tür zum Friedensaal ein älterer Polizist mit Schlagstock. Wir schauten uns in dem tobenden Geschrei und Gedränge an. Er sagte: Bitte nicht. Ich steckte die Tüte wieder ein. Er senkte den Stock. Herr Kiesinger gelangte zu seinem Krameramtsmahl. Faschist, Nazi, schrien Tausende. Sie hatten recht. Viele in diesem Nachkriegsdeutschland waren ehemalige Nazis, dachten und handelten reaktionär. Millionen ermordet, beraubt, aber kaum Verurteilungen. Alle schwiegen, alle hatten nichts gesehen
Unsere inzwischen kleine rote Zelle fuhr zweimal die Woche nachts zu den Faserwerken Hüls in Marl. Wir wollten, dass die Arbeiter rote Betriebsräte wählten. Es war Winter 1969. Ein Arbeiter sagte zu mir: Mädchen, du frierst ja. Ich spendiere dir einen Kaffee. Er erzählte von seiner Arbeit, seiner Familie. Ich dachte, wie komme ich dazu, so einem Menschen zu sagen, was er tun soll. Ich habe doch gar keine Ahnung. Ich war bürgerlich. Ich sollte mich um meine Dinge kümmern. In der bürgerlichen Wohnstube aufräumen.
Wenige Wochen später lösten wir unsere Zelle auf. Wir gründeten eine Buchhandlung. Ich baute mit anderen das erste Frauenzentrum in Münster auf. Ich las begierig. Jahre später gründete ich den Verlag Frauenpolitik. Ich kam bei all diesen Engagements immer an eine Grenze. Ich wurde kunterbunt beschimpft als faschistische Luxemburgistin, rechte Sozialistin, Anarchistin und begriff mit den Jahren, dass ich mit meiner Familiengeschichte immer eine Bürgerliche blieb, die inbrünstig sich wünschte, dass alle einander achteten. Ich habe meine Großeltern nicht erleben dürfen, aber manchmal dachte ich, es ist, als hätten sie mich erzogen. Auch Onkels und Tanten sagten: Respektiere die Arbeit und das Leben anderer. Mit dem Engagieren hörte ich nie auf, aber es gab immer eine ›Werthaltungsanalyse‹. Und die große Begeisterung für Freundlichkeit.
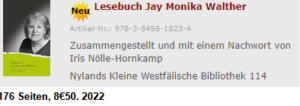
Porträt J. Monika Walther von Matthias Engels

Video-Porträt
- entstanden im Rahmen des Projektes „und seitab liegt die Stadt“ des Fördervereins der Stadtbücherei Steinfurt, gefördert vom Literarischen Colloquium Berlin. Thema der Reihe ist: Herkunft. J. Monika Walthers umfangreiches Werk kreist diesen Begriff in vielfältiger Weise ein und setzt sich mit ihm auseinander.
Monika Detering

Es sind die Menschen, die Monika Detering faszinieren, die Geschichten hinter den Gesichtern. Aus den Denkmodellen werden Romane und Kriminalromane. Die Prüderie der 50er Jahre ist mit psychischer und physischer Gewalt an einem Kind in „Die Kraft ihres Herzens“ eindringlich vertreten. Matheelfe schreibt zum Beispiel: „Es zeigt, wie subtil Missbrauch funktionieren kann und welch lebenslange Spuren er in der Seele hinterlässt. Ein letztes Zitat dazu, welches fast am Schluss des Buches steht, möge meine Rezension abrunden, ‚… Erinnerung kam gestern und heute, als das Leben mir gehörte, ich alle Hoffnung und jeden Traum an dieses hatte. Morgen werde ich mich nicht mehr erinnern.“
Auch die historischen Ruhrgebietskrimis, eine Reihe, die 1951 beginnt, zeigen jene Zeit und die Beengtheit, in denen Menschen damals lebten. Auch den bislang letzten, „Bittere Liebe an der Ruhr“ schrieb die Autorin zusammen mit Horst-Dieter Radke. >Die 1950er Jahre im Ruhrgebiet bieten die Kulisse für dramatische Ereignisse im Umfeld der Literatur<. Die zuletzt erschienen Romane von Detering: „Ich bin Hermann“ und „Der Sommer des Raben“ zeigen auch in der großen Verschiedenheit der Geschichten Menschen mit ihren Hoffnungen, Begierden und Wünschen. Ist es im Hermann-Roman die letzte Liebe und das endgültige Abschiednehmen im Alter das vorrangige Thema, so führt die Suche nach der geheimnisvollen Rabenmarionette den Leser nach Hiddensee und Prag und letztendlich bis in die 1930er Jahre.
 Monika Detering wollte früh aus ihrer Familie heraus, träumte davon, Schiffsjunge, Malerin und Schriftstellerin zu werden. Für immer nach Paris – aber das Leben änderte die Wege. Lebensbrüche führten sie spät, aber endlich dahin – zum Schreiben. Ihre langjährige Erfahrung als Puppenkünstlerin mit dem Herstellen von Portraits, den vielen Ausstellungen im In- und Ausland ließen sie immer bei dem Blick auf den Menschen hinter dem Menschen.
Monika Detering wollte früh aus ihrer Familie heraus, träumte davon, Schiffsjunge, Malerin und Schriftstellerin zu werden. Für immer nach Paris – aber das Leben änderte die Wege. Lebensbrüche führten sie spät, aber endlich dahin – zum Schreiben. Ihre langjährige Erfahrung als Puppenkünstlerin mit dem Herstellen von Portraits, den vielen Ausstellungen im In- und Ausland ließen sie immer bei dem Blick auf den Menschen hinter dem Menschen.
www.monika-detering.de
hoermordkartell.de
http://langeooger-liebestöter.blogspot.com/
http://detering-witwenlust.blogspot.com
http://einmeer.blogspot.com
http://ostseekrimi.blogspot.com/
Bilder: ©Privat ©Br. Wolfgang Mauritz
J. Monika Walther
 Undine Marion Pelny über Goldbroiler oder Die Beschreibung einer Schlacht: „Nach dem Lesen dieses Buches ist klar, dass es um mehr als um Mord und Totschlag geht. Und es ist keine leichte Kost, weil diese Geschichte fast unerträglich nah am Leben ist. Wir sind in Rostock nach der Wende. Der als Revolution gefeierte gesellschaftliche Umbruch hinterlässt im Osten Deutschlands wirtschaftliche und menschliche Verwüstung. Der Zusammenbruch der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Ausländerfeindlichkeit, Schmuggel und Menschenhandel, Verarmung und Resignation – all das schwappt rückhaltlos auch in das Leben von Ida Waschinsky, die sich als Privatdetektivin eine neue Existenz aufzubauen versucht. Sie droht, sich im Strudel der Ereignisse zu verlieren und mit ihr der Leser, er geht mit ihr in die Irre sowohl bei der Suche nach dem Mörder als auch bei der Suche nach der Liebe. Er gerät wie Ida in den Sog der sich entfaltenden Handlungsstränge und es ist letztlich der Blick hinter die Kulissen dieser Nachwendezeit, die ihm den Atem stocken lässt. J. Monika Walther löst das Versprechen des Titels ein: es ist eine Schlacht, bei der jede/r ums Überleben kämpft.
Undine Marion Pelny über Goldbroiler oder Die Beschreibung einer Schlacht: „Nach dem Lesen dieses Buches ist klar, dass es um mehr als um Mord und Totschlag geht. Und es ist keine leichte Kost, weil diese Geschichte fast unerträglich nah am Leben ist. Wir sind in Rostock nach der Wende. Der als Revolution gefeierte gesellschaftliche Umbruch hinterlässt im Osten Deutschlands wirtschaftliche und menschliche Verwüstung. Der Zusammenbruch der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Ausländerfeindlichkeit, Schmuggel und Menschenhandel, Verarmung und Resignation – all das schwappt rückhaltlos auch in das Leben von Ida Waschinsky, die sich als Privatdetektivin eine neue Existenz aufzubauen versucht. Sie droht, sich im Strudel der Ereignisse zu verlieren und mit ihr der Leser, er geht mit ihr in die Irre sowohl bei der Suche nach dem Mörder als auch bei der Suche nach der Liebe. Er gerät wie Ida in den Sog der sich entfaltenden Handlungsstränge und es ist letztlich der Blick hinter die Kulissen dieser Nachwendezeit, die ihm den Atem stocken lässt. J. Monika Walther löst das Versprechen des Titels ein: es ist eine Schlacht, bei der jede/r ums Überleben kämpft.
Selten findet man diese (ostdeutsche) Tragödie so minutiös, so detailliert, so lebensnah beschrieben. Und in allem erweist sich J. Monika Walther zum wiederholten Male als eine große Erzählerin – schonungslos, manchmal brutal und doch fast zärtlich im Umgang mit ihren Protagonisten, niemals voyeuristisch, niemals wertend. „Wir müssen wahre Sätze finden“, hat Ingeborg Bachmann einmal gesagt. J. Monika Walther hat wahre Sätze gefunden und ein Buch geschrieben, das mehr über die Folgen eines gesellschaftlichen Umbruchs erzählt, als in jedem Geschichtsbuch steht. Es verdient den Titel „Geschichte“ – im literarischen wie historischen Sinne. Dass dieser Teil der deutschen Geschichte schon in der Realität ein einziger Krimi war (und ist), spiegelt „Goldbroiler“ nur allzu gut.“

J. Monika Walther, geboren in Leipzig, stammt aus einer jüdisch-protestantischen Familie, aufgewachsen in Leipzig und Berlin – und kreuz und quer in der ganzen Westrepublik; lebt seit 1966 im Münsterland und den Niederlanden, arbeitet seit 1976 als Schriftstellerin: Lyrik, Hörspiel, Prosa. Und immer wieder schreibt sie erfolgreiche Kriminalgeschichten. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, Preise und Stipendien. Zuletzt erschienen Dorf – Milch und Honig sind fort; Am Weltenrand, Prosa; Abrisse im Viertel, Gedichte 2010 -2015. Die Kriminalromane: Goldbroiler oder Die Beschreibung einer Schlacht. Himmel und Erde – Kommissar Simonsberg ermittelt. Kriminalgeschichten sind zu hören beim Hörmordkartell.
www.jmonikawalther.eu
ausdemalltag
Schreibhaus NL
Literaturline Stadt Münster
 Ich wünsche mir die Fähigkeit, auf meinem Platz zu leben, keinem besonderen und an keinem besonderen historischen Ort, schon an gar keinem, der erst erkämpft, weggenommen werden müßte. Ich möchte lernen in Skizzen zu leben und für jeden geglückten Tag an meinem Ort mit meinem Glück oder Unglück, mit meinem Mut oder meiner Feigheit einzustehen.
Ich wünsche mir die Fähigkeit, auf meinem Platz zu leben, keinem besonderen und an keinem besonderen historischen Ort, schon an gar keinem, der erst erkämpft, weggenommen werden müßte. Ich möchte lernen in Skizzen zu leben und für jeden geglückten Tag an meinem Ort mit meinem Glück oder Unglück, mit meinem Mut oder meiner Feigheit einzustehen. So war das also – mein Zustand am Anfang der vielen dann folgenden Che faros – Was mache ich heute.
So war das also – mein Zustand am Anfang der vielen dann folgenden Che faros – Was mache ich heute.
 Meine Mutter und ich kamen über alle Zonengrenzen bis an den Bodensee und fanden einen Unterschlupf in der Drachenstation, direkt an der zerstörten Ufermauer gelegen. Ein neuer Lebensroman. Der Sinn war zu leben. Nach dem Überleben. In der Fremde zu leben.
Meine Mutter und ich kamen über alle Zonengrenzen bis an den Bodensee und fanden einen Unterschlupf in der Drachenstation, direkt an der zerstörten Ufermauer gelegen. Ein neuer Lebensroman. Der Sinn war zu leben. Nach dem Überleben. In der Fremde zu leben. Friedrichshafen war eine sehr zerbombte Stadt. Die vier großen Rüstungsbetriebe Luftschiffbau Zeppelin, Maybach Motorenbau, die Zahnradfabrik und die Dornierwerke waren Ziel der Angriffe gewesen. Vierzehntausend ausländische Zwangsarbeiter und über tausend KZ-Häftlinge schufteten in diesen Werken. Bis April 1945 errichteten Häftlinge einen unterirdischen Stollen bei Überlingen, den Goldbacher Stollen, um die Rüstungsindustrie aus Friedrichshafen zu verlagern. Elf Luftangriffe gab es zwischen 1943 und Februar 1945. Nur der Mut des Bürgermeisters und vieler Einwohner verhinderte, dass die Stadt bis zum letzten Haus verteidigt wurde. Zum Kriegsende lebten nur noch siebendtausendsechshundertfünfzig Menschen in der Stadt. Bei Kriegsbeginn waren über fünfundzwanzigtausend gewesen. Die drei Männer aus der Baracke neben der Drachenstation waren Häftlinge gewesen, Ukrainer. Nach Hause wollten sie auf keinen Fall, nicht in die Hände der Russen fallen. Das hätte ihren Tod bedeutet.
Friedrichshafen war eine sehr zerbombte Stadt. Die vier großen Rüstungsbetriebe Luftschiffbau Zeppelin, Maybach Motorenbau, die Zahnradfabrik und die Dornierwerke waren Ziel der Angriffe gewesen. Vierzehntausend ausländische Zwangsarbeiter und über tausend KZ-Häftlinge schufteten in diesen Werken. Bis April 1945 errichteten Häftlinge einen unterirdischen Stollen bei Überlingen, den Goldbacher Stollen, um die Rüstungsindustrie aus Friedrichshafen zu verlagern. Elf Luftangriffe gab es zwischen 1943 und Februar 1945. Nur der Mut des Bürgermeisters und vieler Einwohner verhinderte, dass die Stadt bis zum letzten Haus verteidigt wurde. Zum Kriegsende lebten nur noch siebendtausendsechshundertfünfzig Menschen in der Stadt. Bei Kriegsbeginn waren über fünfundzwanzigtausend gewesen. Die drei Männer aus der Baracke neben der Drachenstation waren Häftlinge gewesen, Ukrainer. Nach Hause wollten sie auf keinen Fall, nicht in die Hände der Russen fallen. Das hätte ihren Tod bedeutet.

 Begonnen hatte ich vor Jahren mit vierzig Seiten über meinen Geburtsort Leipzig, die ich atemlos geschrieben habe, aber wie weiter? Auf der Suche nach Wahrheit tauchen viele Legenden auf, kleine und große Geschichten, die nicht wahr sind und doch erzählen, was gewesen ist oder gewesen sein sollte. Eine Selbstbeschau sind die Fluchtlinien nicht. Nein, ich schreibe die Geschichte einer Familie, meiner jüdischen, schlesischen, preußischen Familie, die Wanderungen von Ost nach West, der schließlich gelungene Aufstieg während der Gründerzeit in Leipzig; ich schreibe diese Geschichte so wahr wie möglich, aber eben auch mit ihren Legenden, Lügen und all den schwarzen Flecken. Und da ich ja dazu gehöre, schreibe ich auch über mich. Meinen Weg vom Rand, vom Nichtwissen bis hin zum Begreifen, wie ich dazugehöre.
Begonnen hatte ich vor Jahren mit vierzig Seiten über meinen Geburtsort Leipzig, die ich atemlos geschrieben habe, aber wie weiter? Auf der Suche nach Wahrheit tauchen viele Legenden auf, kleine und große Geschichten, die nicht wahr sind und doch erzählen, was gewesen ist oder gewesen sein sollte. Eine Selbstbeschau sind die Fluchtlinien nicht. Nein, ich schreibe die Geschichte einer Familie, meiner jüdischen, schlesischen, preußischen Familie, die Wanderungen von Ost nach West, der schließlich gelungene Aufstieg während der Gründerzeit in Leipzig; ich schreibe diese Geschichte so wahr wie möglich, aber eben auch mit ihren Legenden, Lügen und all den schwarzen Flecken. Und da ich ja dazu gehöre, schreibe ich auch über mich. Meinen Weg vom Rand, vom Nichtwissen bis hin zum Begreifen, wie ich dazugehöre.


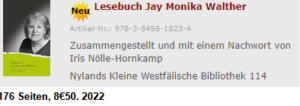


 Monika Detering wollte früh aus ihrer Familie heraus, träumte davon, Schiffsjunge, Malerin und Schriftstellerin zu werden. Für immer nach Paris – aber das Leben änderte die Wege. Lebensbrüche führten sie spät, aber endlich dahin – zum Schreiben. Ihre langjährige Erfahrung als Puppenkünstlerin mit dem Herstellen von Portraits, den vielen Ausstellungen im In- und Ausland ließen sie immer bei dem Blick auf den Menschen hinter dem Menschen.
Monika Detering wollte früh aus ihrer Familie heraus, träumte davon, Schiffsjunge, Malerin und Schriftstellerin zu werden. Für immer nach Paris – aber das Leben änderte die Wege. Lebensbrüche führten sie spät, aber endlich dahin – zum Schreiben. Ihre langjährige Erfahrung als Puppenkünstlerin mit dem Herstellen von Portraits, den vielen Ausstellungen im In- und Ausland ließen sie immer bei dem Blick auf den Menschen hinter dem Menschen. Undine Marion Pelny über Goldbroiler oder Die Beschreibung einer Schlacht: „Nach dem Lesen dieses Buches ist klar, dass es um mehr als um Mord und Totschlag geht. Und es ist keine leichte Kost, weil diese Geschichte fast unerträglich nah am Leben ist. Wir sind in Rostock nach der Wende. Der als Revolution gefeierte gesellschaftliche Umbruch hinterlässt im Osten Deutschlands wirtschaftliche und menschliche Verwüstung. Der Zusammenbruch der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Ausländerfeindlichkeit, Schmuggel und Menschenhandel, Verarmung und Resignation – all das schwappt rückhaltlos auch in das Leben von Ida Waschinsky, die sich als Privatdetektivin eine neue Existenz aufzubauen versucht. Sie droht, sich im Strudel der Ereignisse zu verlieren und mit ihr der Leser, er geht mit ihr in die Irre sowohl bei der Suche nach dem Mörder als auch bei der Suche nach der Liebe. Er gerät wie Ida in den Sog der sich entfaltenden Handlungsstränge und es ist letztlich der Blick hinter die Kulissen dieser Nachwendezeit, die ihm den Atem stocken lässt. J. Monika Walther löst das Versprechen des Titels ein: es ist eine Schlacht, bei der jede/r ums Überleben kämpft.
Undine Marion Pelny über Goldbroiler oder Die Beschreibung einer Schlacht: „Nach dem Lesen dieses Buches ist klar, dass es um mehr als um Mord und Totschlag geht. Und es ist keine leichte Kost, weil diese Geschichte fast unerträglich nah am Leben ist. Wir sind in Rostock nach der Wende. Der als Revolution gefeierte gesellschaftliche Umbruch hinterlässt im Osten Deutschlands wirtschaftliche und menschliche Verwüstung. Der Zusammenbruch der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Ausländerfeindlichkeit, Schmuggel und Menschenhandel, Verarmung und Resignation – all das schwappt rückhaltlos auch in das Leben von Ida Waschinsky, die sich als Privatdetektivin eine neue Existenz aufzubauen versucht. Sie droht, sich im Strudel der Ereignisse zu verlieren und mit ihr der Leser, er geht mit ihr in die Irre sowohl bei der Suche nach dem Mörder als auch bei der Suche nach der Liebe. Er gerät wie Ida in den Sog der sich entfaltenden Handlungsstränge und es ist letztlich der Blick hinter die Kulissen dieser Nachwendezeit, die ihm den Atem stocken lässt. J. Monika Walther löst das Versprechen des Titels ein: es ist eine Schlacht, bei der jede/r ums Überleben kämpft.